In den Frühlingsferien besuchten wir das Kennedy Space Center in Florida. Das erste, was einem beim Betreten des Geländes ins Auge fällt, sind die zahlreichen, im „Rocket Garden“ ausgestellten, Raketen. Grundsätzlich interessiere ich mich für alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, so sehr, dass meine Familie mich am KSC absetzen und nächstes Jahr wieder abholen könnte. Und doch realisierte ich erst beim diesjährigen Besuch, dass die meisten dieser Raketen ursprünglich als ballistische Rakete für den Transport von Atomsprengköpfen konzipiert worden waren. Sie wurden während dem Space Race zur Zeit des Kalten Krieges gebaut - einer Zeit, wo die USA und die Sowjetunion darum rangen, wer das Weltraum am schnellsten erforschen und erobern konnte.
Die meisten dieser Raketen waren zum Töten gedacht. Doch brachten sie schlussendlich Menschen ins All. Die internationale Raumstation beherbergt heute Astronauten aus verschiedenen Nationen, darunter auch Teams, die aus den USA und Russland zusammenarbeiten. Wie wurde das möglich?
Als die politischen Spannungen der beiden Länder nachzulassen begannen, verlagerte sich der Fokus der NASA und der CCCP (ihr sowjetisches Gegenstück). Wenn Angst und Verteidigung in der Prioritätenliste nach unten rutschen, öffnet sich der Raum für Abenteuer und Exploration. Für die Entdeckung des Weltraums. Für die Möglichkeit, einen Fuß auf den Mond zu setzen, und vielleicht eines Tages sogar auf den Mars. Gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, die für eine einzelne Nation ist zu groß. Der Auslöser für die Umwandlung von Raketen in Weltraumforschungsgeräte war die Hoffnung auf Frieden. Mit dem Ende des Kalten Krieges wurde diese Hoffnung stärker, und der Traum einer gemeinsamen Erforschung des Weltraums wurde Wirklichkeit.
Als ich an diesem Frühlingstag im Rocket Garden stand, dachte ich plötzlich nicht mehr an den Weltraum. Ich dachte an meinen Glauben. Wie dieses Prinzip nicht nur für den Weltraum, sondern auch für den Glauben gilt, und zwar noch mit viel größeren Konsequenzen. Solange wir mit Angst beschäftigt sind und damit, die vermeintlichen Feinde unseres Glaubens zu bekämpfen, werden wir religiöse Raketen bauen – Waffen, die verletzen und töten - und wir werden unfähig sein, auf geistlicher Ebene auch nur den kleinsten Durchbruch zu erleben.
Erst wenn die Neugierde siegt, können unsere Gedanken zu den Sternen wandern und wir können gemeinsam an Errungenschaften arbeiten, die für uns alleine unerreichbar wären. Auf den Weltraum bezogen bedeutet das, Planeten zu erforschen. Auf die geistliche Welt bezogen bedeutet es die Erforschung des Friedens.
Der deutsche christliche Theologe Siegfried Zimmer arbeitet seit Jahrzehnten mit muslimischen und jüdischen Theologen an verschiedenen Projekten zum Dialog der Religionen. Er hat ein Papier veröffentlicht, das über mehrere Seiten lang grundlegende Glaubensaussagen bespricht, auf die sich namhafte Vertreter aller drei Religionen einigen können. Er pflegt langjährige Freundschaften mit Mullahs und Rabbinern aus aller Welt.
In einem höchst faszinierenden Vortrag sagte er kürzlich, dass die grundlegendste Voraussetzung für jeden Dialog zwischen den Religionen der Wunsch ist, nach dem zu suchen, was uns eint, statt nach dem, was uns trennt. "Bevor ein Christ auch nur eine Kritik am Koran lesen sollte, sollte er immer zuerst zwei positive Bücher über den Koran lesen müssen."
Worin besteht die Weisheit in diesem Ratschlag? Weil man, wenn man mit der Kritik und den Dingen, die uns trennen, beginnt, die Angst und das Misstrauen aktiviert. Und aus der Position der Angst heraus werden wir weiter metaphorische Raketen bauen, deren einzige Funktion das Zerstören ist. Aber wenn wir uns dem Unbekannten mit Neugier nähern, dann wird die Vision gemeinsamen Bauens möglich. Ein Beispiel dafür ist die Organisation Parents Circle, eine religionsübergreifende Vereinigung von Palästinensern und Israeli. Um dieser Gruppe anzugehören, muss man ein Elternteil eines Kindes sein, das dem gewaltsamen Konflikt der beiden Volksgruppen zum Opfer fiel. Zusammen arbeiten diese Eltern an Vergebung, Respekt und einem friedlichen Weg heraus aus dem jahrhundertealten Konflikt. Was sie bauen ist stärker, als was Worte ausdrücken können.
Vielleicht denken Sie beim Lesen dieser Zeilen „Das ist ja alles gut und schön, aber die Unterschiede sind einfach zu groß, und wir werden nie auf gleicher Augenhöhe sein.“ Das liegt möglicherweise daran, dass so vielen von uns (unbewusst) beigebracht wurde, sich auf die Verteidigung und den Schutz unseres Glaubens zu konzentrieren, anstatt ihn zu erforschen und zu feiern. Ich weiß das, weil ich selbst viel zu lange mit dieser Denkweise gelebt habe. Ich war gegen so viele Dinge, von denen ich gar keine Ahnung hatte, dass es sowohl peinlich als auch traurig ist. Aber so muss es nicht bleiben!
Die erste Sorge, die normalerweise formuliert wird, ist, dass mit der Suche nach Gemeinsamkeiten unser Glaube "verwässert" wird. Doch was, wenn es ihn stattdessen stärker, liebevoller und erstrebenswerter machen würde? Bauen Sie lieber an einer Rakete, die Menschen tötet, oder an einer, die sie auf den Mond schickt? Vielleicht ist es an der Zeit, unsere geistlichen Bemühungen vom Verteidigen zum Erforschen zu verlagern – zusammen mit denen, die wir nicht verstehen.
Unterschiedliche Religionen sind jedoch nicht die einzigen Brutstätten für Angst und Hass. In den USA geschieht im Moment zwischen den zwei politischen Parteien dasselbe, und auch gegenüber anderen Ländern ist die Versuchung groß, sich lieber zu verbarrikadieren als den anderen einzuladen. Aber die vielleicht traurigste Form solch reaktionären Lebens ist, wenn Angst als Glaube getarnt wird. Wenn wir aufgrund arroganter und falscher Annahmen unser Land als Gottes auserwählte Nation bezeichnen und uns dem anschließen, was Brian Zahnd die "Liturgie des Nationalismus" nennt. Wenn unsere Flagge hinter Kanzeln weht, die eigentlich Gottes Liebe zu allen Nationen predigen sollten. Wenn Kirchen den Nationalismus feiern, anstatt ihn prophetisch herauszufordern. Und wenn Christen sich in politischen Gräben verirren und am Ende unbarmherzigen und hasserfüllten Politikern ins Amt helfen.
Mein Besuch im Kennedy Space Center begann mit einer Lektion darüber, wie alltäglich dieses Spannungsfeld um mich herum ist. Kurz vor Einlass um 10 Uhr, während Hunderte von Besuchern bereits Schlange standen, wurde über den Lautsprecher die Nationalhymne abgespielt. Die Menschenmenge drehte sich um, Blick auf die Flagge gerichtet, die Hände über der Brust. Wie immer, wenn ich mit diesem Ausdruck nationaler Liturgie konfrontiert bin, fühlte ich mich unwohl. Ich habe keinen Wunsch, die Gefühle von irgendjemandem zu verletzen. Aber die ritualisierte Verehrung eines Symbols des Nationalismus geht so sehr gegen meinen Instinkt, dass ich mich nicht zum Mitmachen durchringen kann. Also stehe ich, unschlüssig, und versuche, den Moment zu mir sprechen zu lassen. Denn Flaggen und Hymnen sind nicht das einzige, das versucht, die Welt in "wir und sie" zu unterteilen. Der Instinkt, die Unterschiede zu erkennen, mag immer intuitiver bleiben als die Suche nach dem Gemeinsamen. Aber das Space Center ist gleichzeitig eine Erinnerung daran, dass selbst innerhalb dieser Spannung erstaunliche Dinge geschehen können. Obwohl die USA nicht widerstehen konnten, eine amerikanische Flagge auf den Mond zu stellen, feiern sie jetzt auch die internationalen wissenschaftlichen Fortschritte, die auf der ISS erzielt wurden. Es gibt Hoffnung.
Vielleicht können wir aus der Tatsache lernen, dass es im Weltraum keine Luft gibt, um eine Flagge zu schwenken. Der Astrophysiker Neil DeGrasse Tyson jedenfalls hat dies treffend kommentiert. Mit genügend Neugier und Vertrauen können wir über angstgetriebene Phänomene wie Nationalismus, Islamophobie oder Antisemitismus hinauswachsen - und durch die Entdeckung von Aspekten der Welt, die wir vorher nie wahrgenommen haben, tiefer und weiter in unsere eigene Kultur und unseren Glauben hineinwachsen.
Mit einer solchen Herzenshaltung wird der Friede zu einer Realität, welche die der Angst und Gewalt bei weitem übertrifft.
Zur Vertiefung: Interview mit einem palästinensischen und jüdischen Vertreter des Parent Circle unter der Leitung von Christine Amanpour, CNN (Englisch), Mai 2021: https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/05/14/amanpour-robi-damelin-bassam-aramin-israel-palestinian-territories-peace.cnn
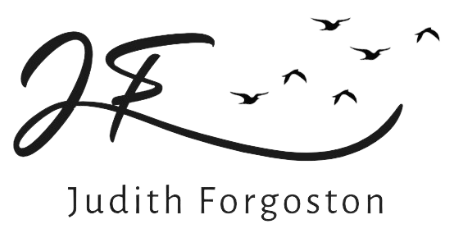



Kommentar hinterlassen